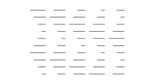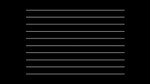THIS ARROW POINTS
A 2025 | DCP or Digtial File | b&w | Dolby 5.1 | 2 Minutes
Irgendwann bin ich über den Satz „Wie kommt es, dass der Pfeil zeigt?“ gestolpert. Seit dem lässt mich diese Frage, die Ludwig Wittgenstein in seinen „Philosophischen Untersuchungen“ formuliert hat, nicht mehr los. Hauptthema der „Untersuchungen“ ist der Grundsatz, dass die Bedeutung eines Ausdrucks sein Gebrauch in der Sprache ist. Daraus abgewandelt, beschäftigt mich die Aufgabe, wie ein Ausdruck im filmischen Gebrauch seine Bedeutung erhält, vor allem, wenn es sich um abstrakte Ausgangsbilder handelt. This Arrow Points ist ein erstes Ergebnis meiner „Untersuchungen“ dazu.
In meiner filmkünstlerischen Arbeit bediene ich mich häufig sogenannter „Kaderpläne“ – schriftlicher oder zeichnerischer Partituren, in denen jedes einzelne Bild eines Films präzise verzeichnet ist. Diese Methode habe ich mir – inspiriert von verschiedensten Protagonist*innen des historischen Avantgardefilms – angeeignet und weiterentwickelt. Die grafischen Ausdrucksformen dieser Strukturpläne besitzen eine eigene, autonome Ästhetik, die weit über ihre bloße Funktion als Beipackzettel zum Film hinausreicht. Es war mir nie genug, sie lediglich als begleitende Notate zu begreifen – darum habe ich sie nun zum alleinigen visuellen Motiv eines Films erhoben.
Die visuellen Sujets bilden die zeitliche Struktur der Bildabfolgen ab; sie sind zugleich Abstraktion und Exposition. Die Filmbilder selbst fungieren als Chiffren für ihre eigene Sequenz – THIS ARROW POINTS ist somit eine Verschränkung von Chronographie und Chronologie. Die „Schrift des Sehens“ (Peter Weibel) wird in diesem Werk zu einem artikulierten Satz einer konkreten Filmsprache.
(Siegfried A. Fruhauf)
Immer wieder erstaunt Siegfried A. Fruhauf mit einem neuen Experiment innerhalb seines reichen filmischen Werks. Oft überträgt er einzelne Fotografien oder wenige Kader in einen von strukturellen Ideen und Plänen angetriebenen Bewegungsablauf, der darüber hinaus Genres des Erzählkinos in einer fragmentierten und verdichteten Form aufblitzen lässt: vom Melodram bis zum Horrorspektakel. In This Arrow Points erscheinen keine figurativen Abbilder oder Schemen, alleine abstrakte schwarze oder weiße Linien sind das Material für die Animation.
Der Ausgangspunkt ist eine philosophische Frage von Ludwig Wittgenstein: „Wie kommt es, dass der Pfeil zeigt?“, welche er (mit anderen) als Nachweis für die Bedeutung eines Ausdrucks durch seinen Gebrauch in der Sprache bekräftigt. Daran anschließend untersucht Siegfried A. Fruhauf, wie abstrakte Konfigurationen ihren Ausdruck im kinematografischen Ablauf erreichen. Mit der Überlegung, die grafischen Aufzeichnungen und Diagramme, die die Grundlage seiner strukturellen Arbeiten darstellen, für diesen Film zu verwenden, wendet sich der Künstler dem Konzeptfilm zu. Obwohl die Überlegung einer möglichen Bedeutung von Linien in unterschiedlichen Längen und Abständen in einer zeitlichen Dimension als allzu theoretisch und für den/die Betrachter:in als sinnlich unergiebig erscheinen müssen, gelingt aufgrund des Zusammenspiels von elektronischem Sound und optischen Reizen ein ekstatisches filmisches Ereignis. Fruhauf analysiert die Wirkung der grafischen Elemente eben nicht in einem Essay sondern schafft mit den illusionistischen Möglichkeiten des Films synästhetische Effekte. Ob die Flicker und die daraus resultierenden Nachbilder auf der Netzhaut Farben simulieren oder eine Stimmung der Berauschung hervorrufen, ob die Beschleunigung einen Anstieg zu einem möglichen Höhepunkt und darauffolgender Entspannung evoziert, bleibt jedem/r überlassen.(Brigitta Burger-Utzer)

At some point, I stumbled across the sentence “How is it that the arrow points?”. Since then, this question, formulated by Ludwig Wittgenstein in his “Philosophical Investigations”, has stayed with me. The main theme of the “Investigations” is the principle that the meaning of an expression is its use in language. Modified from this, I am concerned with the task of how an expression acquires its meaning in cinematic use, especially when it comes to abstract source images. This Arrow Points is a first result of my “investigations” into this.
(Siegfried A. Fruhauf)
Siegfried A. Fruhauf astonishes yet again with a new experiment in his rich cinematic oeuvre. He often transfers individual photographs or a few
frames into a sequence of movements driven by structural ideas and plans, which also results in genres of narrative cinema erupting in a fragmented and condensed form: from melodrama to
horror spectacle. In This Arrow Points, however, no figurative images or silhouettes appear; abstract black and white lines are the sole material used in the
animation.
The point of departure is a philosophical question by Ludwig Wittgenstein: “How does it come about that this >>>→ arrow points?”,
which he (and others) affirms as proof of the meaning of a concept through its use in language. Siegfried A. Fruhauf then investigates how abstract configurations achieve their expression in
the process of cinematography. By considering the graphic recordings and diagrams of his structural works as a basis for this film, the artist turns to conceptual film. Even though the viewer
is placed in a position of considering the possible meaning of lines of varying lengths and distances in a temporal dimension – in all likelihood an overly theoretical and sensually
unproductive activity – the interplay of electronic sound and optical stimuli creates an ecstatic cinematic experience. Fruhauf does not analyze the effect of the graphic elements in an essay
but rather creates synaesthetic effects using the illusionistic possibilities of film. The question of whether the flickering and the resulting afterimages on the retina simulate colors or
evoke a mood of intoxication, whether the acceleration evokes a rise to a possible climax and subsequent relaxation, is up to each individual viewer.
(Brigitta Burger-Utzer, Translation: John Wojtowicz)